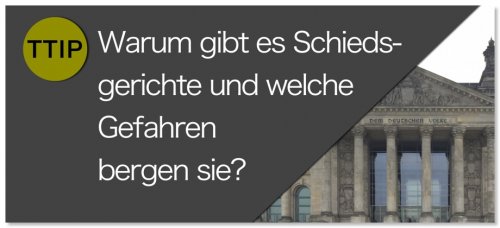Mittlerweile kann man getrost sagen, dass Schiedsgerichte zu dem umstrittensten Thema rund um TTIP gehören. Viele Kritiker sagen, dass selbst wenn das TTIP-Abkommen sonst gut wäre - und das ist nicht der Fall -, dann müsste man es trotzdem ablehnen, sofern Investorenschutzklauseln weiterhin Bestandteil des Abkommens bleiben.
Ich habe mich bisher zurückgehalten zu diesem Thema, weil ich sehr wenig darüber wusste. Ich kenne zwar die Argumente der Kritiker, wie Pia Eberhardt, Thilo Bode und Franz Kotteder, aber ich wollte auch die Argumente der Befürworter hören. Zu meinem Erstaunen musste ich feststellen, dass Schiedsgerichte auch in der Fachwelt umstritten sind. Sie erfüllen ein Zweck, bergen aber auch große Gefahren.
Ich werde in kommenden Artikel versuchen das Thema aus verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten. In diesem Artikel möchte ich drei Fragen beantworten:
1. Warum gibt es Schiedsgerichte?
2. Welches Problem wollen Schiedsgerichte lösen?
3. Welche Gefahren bergen sie heute?
Warum gibt es Investitionsschutzabkommen?
Vor kurzem beendete ich Dani Rodriks Buch Das Globalisierungs-Paradox, das ich jedem empfehle, der mehr über kommende Probleme der wirtschaftlichen Integration erfahren möchte. In diesem Buch kann man auch gut nachbilden, wo Schiedsgerichte ihren Ursprung haben und warum sie so kontrovers sind.
Prof. Steffen Hindelang, von der Freien Universität Berlin, sagt, dass Investitionsschutzabkommen eine Ablösung der klassischen gun boat diplomacy darstellen. Und Dani Rodrik führt uns in diese Form der Diplomatie ein.
Liberale Wirtschaftsdenker wollen uns immer wieder weiß machen, dass Globalisierung ein rein wirtschaftlicher Prozess ist und allen voran dann am besten funktioniert, wenn sich Politik raushält. Doch wie wurde der internationale Handel und Globalisierung überhaupt möglich?
Im 17. Jahrhundert war die Welt noch weitestgehend unentdeckt und der Überseehandel gehörte zu einem der riskantesten Geschäfte schlechthin. Haben Unternehmen und Konzerne damals ebenfalls darauf bestanden, dass sich Politik raushält? Nein. Globalisierung wurde nur durch Politik möglich. Tatsächlich hat der Politikwissenschaftler David Cameron bereits 1978 nachgewiesen, dass mit zunehmender Globalisierung auch der öffentliche Sektor expandiert ist und zwar wegen der wirtschaftlichen Integration.
Dani Rodrik sagt uns warum das so ist:
“Market exchange, and especially long-distance trade, cannot exist without rules imposed from somewhere. (…) Where there is globalization, there are rules. What they are, who imposes them, and how - those are the only real questions.” (Rodrik, S. 9)
Man kann getrost sagen, dass bis ins 20. Jahrhundert Staaten dafür sorgten, dass Investoren geschützt wurden. Es waren meisten private Personen, die den Überseehandel organisierten, aber diese Menschen genossen einen besonderen Schutz ihrer Heimatregierung. Ohne diesen Schutz wäre der Handel nicht möglich gewesen. Irgendjemand musste sicherstellen, dass der Handel nach gewissen Regeln abläuft; notfalls mit Gewalt.
Wenn wir heute über Globalisierung sprechen, dann sprechen wir über einen Prozess, der die Grenzen der Nationalstaaten längst hinter sich gelassen hat, aber noch immer auf die Durchsetzung von Regeln angewiesen ist. Das geschieht heute aber nicht mehr mit Gewalt, sondern mit Investitionsschutzabkommen. Dieser Prozess hat nach dem 2. Weltkrieg enorm an Fahrt gewonnen.
Handelskriege gehören seither der Vergangenheit an. Heute werden solche Kämpfe in internationalen Schiedsgerichten entschieden. Aber es geht im Grunde um das gleiche Thema, wie in der gun boat diplomacy: Was tut ein Investor, wenn ein Staaten seine Investitionen tatsächlich gefährdet? Leider wird diese Frage derzeit komplett ausgeblendet, sie ist aber sehr legitim.
Welches Problem wollen Investitionsschutzabkommen lösen?
Sowohl Prof. Hindelang als auch der Jurist Sundaresh Menon sehen das als Fortschritt an. Was nicht bedeutet, dass die Abkommen unproblematisch sind.
Dani Rodrik spricht zu Recht vom Paradox der Globalisierung. Die Wirtschaft kennt keine Grenzen mehr, kann mehr oder minder überall investieren und in der ganzen Welt Geld verdienen. Aber dieser Prozess wird beschnitten durch unterschiedliche Rechtsauffassungen und Regulierungen. Politik und unterschiedlich ausgeprägte nationale Gesetzgebung stellen das größte Hindernis für Investitionen. Staaten haben zwar die Globalisierung befeuert, aber sich gleichzeitig in einer schwierige Lage gebracht: Politik bleibt weiterhin national, aber Investitionen kennen keine Grenzen mehr.
Wirtschaftlich ist also etwas gefördert worden, was politisch ungewollt blieb. In diesem Zusammenhang verweist Sundaresh Menon auf die Tatsache, dass die meisten Staatenbildungen auf die Zeit nach dem 2. Weltkrieg fallen. Politisch wollte man und will man weiterhin national bleiben, wirtschaftlich forciert man eine weltweite Integration. Allerdings verzichten Staaten heute auf den Schutz ihrer Unternehmen. Ein Land zieht heute nicht mehr in den Krieg mit einem Handelspartner, wenn eins seiner Unternehmen enteignet wird oder die Investitionen gefährdet sind.
Investitionsschutzabkommen sollten einfach sicherstellen, dass Unternehmen nicht willkürlich behandelt werden. Dabei sind diese Abkommen zunächst überwiegend zwischen Industrienationen und Entwicklungsländer geschlossen worden und auch in einer Zeit, die wirklich Investitionen riskant machte. Nach dem 2. Weltkrieg war die Gefahr der Enteignung reeller als sie es heute ist; es gab eben zwei Wirtschaftsformen und gerade in Entwicklungsländern konnte ein Investor nie sicher sein, ob das Land nicht doch sozialistisch wird und private Unternehmen einfach verstaatlicht.
Insofern waren gerade die ersten Investitionsabkommen recht fortschrittlich, weil sie eben sicherten, dass ein Konflikt zwischen einem Investor und einem Land nicht mit Gewalt sondern mit Kompensationszahlungen entschieden wurde. Das Mutterland des Unternehmens musste nicht mehr eingreifen, wenn etwas schief lief.
Solche Abkommen sind also Krücken, die ein Manko in der internationalen Politik ausgleichen wollen: Unternehmen wollen und sollen weltweit agieren, aber es gibt keinen globalen Rechtsrahmen, der in Konflikten angerufen werden kann. Das liegt zum Teil eben daran, dass Nationalstaaten ungern die Gesetzgebungskompetenz abgeben.
Die Idee war also gar nicht so schlecht. Aber heute hat sich die Lage verschärft und aus einst sinnvollen Abkommen erwuchs eine Paralleljustiz, die selbst in der Fachwelt kritisch diskutiert wird.
Welche Gefahren bergen Investitionsschutzabkommen?
Aus einer Krücke der ersten Globalisierungsphase nach dem 2. Weltkrieg wurde eine Krake, die heute Staaten in die Knie zwingen kann und die Demokratie enorm belastet. Die Politikwissenschaftlerin Pia Eberhardt hat sich mit dem Thema intensiv befasst und die wesentlichen Problemfelder herausgearbeitet.
Die Idee hinter dieser Form der ad hoc Gerichtsbarkeit lag eben darin, dass schnell entschieden werden konnte und ein Unternehmen nicht die Mühlen der nationalen Gesetzgebung durchlaufen musste. Man war sich einfach nicht sicher, ob ein Unternehmen den Staat vor nationalen Gerichten erfolgreich verklagen kann. Und selbst wenn hier Unparteilichkeit möglich wäre, so blieb immer noch das Problem, dass ein solcher Gerichtsprozess Jahre dauern kann. Das wollte man eben verhindern.
Auch das Völkerrecht kennt dieses Dilemma: Was tut ein Mensch, wenn der Staat an ihm Unrecht begeht? Ein Staat konnte lange Zeit nicht verklagt werden, weil er eben die höchste Instanz war. Heute gibt es unter anderem den Internationalen Gerichtshof den man in solchen Fällen anrufen kann. Schiedsgerichte gehen in die gleiche Richtung, bergen aber große Gefahren.
An dieser Stelle möchte ich nur sechs Problemfelder aufzählen, die solche Schiedsgerichte mehr als diskreditieren.
1. Die Investor-Staat Schlichtung entlehnt sich der internationalen Wirtschaftsschlichtung, einem Modell das ungeeignet ist um solche Streitigkeiten legitim zu lösen.
Wenn zwei Unternehmen in einen Konflikt geraten, dann kann eine Schlichtung im Rahmen eines Schiedsgerichtes durchaus sehr erfolgreich sein, aber wenn ein Investor einen Staat verklagt, der im Sinne der Bürger regiert, dann kann es kein gutes Modell sein. Es geht eben nicht nur um ein Abkommen zwischen zwei Parteien, sondern auch um die Frage, was Bürger begehren. Solche Schiedsgerichte missachten bisher Belange vom öffentlichem Interesse. (Siehe die Studie von David Schneiderman: Investing in Democracy? Political process and international Investment Law, 2010, in: The University of Toronto Law Journal.)
2. Es entscheiden immer nur einige wenige Personen, ob Unrecht begangen wurde und Ihr Urteil ist bindend.
Eine Revisionsmöglichkeit gibt es nicht. Dabei gibt es die Fälle, in denen zwei unterschiedliche Schiedsgerichte zum gleichen Thema genau gegensätzlich entschieden haben. Ferner sind es einige wenige Anwälte und Spezialisten die immer wieder entscheiden. Ein Anwalt kann ebenfalls auch ein Richter sein, was in einem nationalem Rechtssystem unmöglich wäre und die Unparteilichkeit der Akteure sehr in Frage stellt. (Siehe die Studie von Gus Van Harten: Arbitrator Behaviour in Asymmetrical Adjudication: An Empirical Study of Investment Treaty Arbitration )
3. Bisher sind die Tagungen hinter verschlossenen Türen und die Öffentlichkeit erfährt nur selten, was vereinbart wurde.
Obwohl in solchen Schiedsgerichten zunehmend demokratisch legitimierte Politik auf dem Prüfstand steht, sind diese Gerichte völlig intransparent. Niemand, ausser die wenigen Beteiligten, hat Einblick in die Argumentation und Entscheidung. Wir erfahren zwar zunehmend den Inhalt der Verhandlungen, aber sobald das Urteil gefallen ist, nutzt das wenig, weil es eben nicht angefochten werden kann. (Siehe Sundaresh Menon und Pia Eberhard)
4. Die Auslegung der Investitionsschutzabkommen wird immer weitergefasst, weil ein Schiedsspruch zum Präzedenzfall für den nächsten Schiedsspruch wird.
Lange Zeit ging es überwiegend um das Thema “Enteignung”, aber in den letzten Jahren wurde die Auslegungen solcher Abkommen immer großzügiger gehandhabt. Nun werden Staaten nicht mehr verklagt, weil eine tatsächliche Enteignung stattgefunden hat, sondern weil eine Gesetzgebung den Investor angeblich geschädigt hat. (Siehe Sundaresh Menon und Pia Eberhardt / die Studie von Ole Kristian Fauchald kommt hingegen zu einem positiverem Ergebnis)
5. Das System bietet Anwälten eine Anreiz noch mehr Klagen durchzuführen, weil sie so mehr verdienen können.
Stundenlöhne von bis zu 1.000 USD machen solche Klagen zu einem sehr lukrativen Geschäft und bieten deshalb einen Anreiz Verletzungen von Investitionen immer breiter zu fassen.
6. Demokratische Gesetze können durch Schiedsgerichte delegitimiert werden.
Eine der größten Gefahren liegt eben darin, dass einige wenige Menschen darüber entscheiden, ob ein demokratisch legitimiertes Gesetz gut ist. Heute werden tatsächlich zunehmend Gesetze im Sinne der Öffentlichkeit vor solchen Schiedsgerichten angeprangert. (Siehe Sundaresh Menon und David Schneiderman)
Warum beharrt die Europäische Union trotzdem auf eine Investitionsschutzklausel?
Wenn man sich die Liste der Kritikpunkte anschaut - und das sind bei weitem nicht alle -, dann stellt sich unweigerlich die Frage, warum Staaten und derzeit die EU auf solche Klauseln pochen?
Handelspolitik ist heute weitestgehend Investitionspolitik. Staaten sind sehr abhängig von solchen Investitionen und offensichtlich herrscht die Überzeugung vor, dass Investitionsschutzklauseln solche Investitionen anziehen. Das konnte die Wissenschaft noch nicht belegen. Bestenfalls ist das Ergebnis unentschieden, wie Pia Eberhardt nachweist. Derzeit studiere ich noch weitere Artikel zu den Effekten solcher Abkommen.
Dann bliebe noch das Argument, dass die Idee hinter solchen Abkommen durchaus sinnvoll ist. Ein Investor soll weiterhin eine Möglichkeit haben, den Staat zu verklagen, wenn ihm tatsächlich Unrecht zugefügt wurde. Nur sind Schiedsgerichte dafür wirklich gut geeignet? Die SPD hat sich hier schon für eine dauerhafte Instanz ausgesprochen. In solch ein Schiedsgericht würde man Richter dauerhaft einberufen, Transparenz gewährleisten und eine Revisionsmöglichkeit einbauen. Auch Juristen plädieren für solch ein internationales Schiedsgericht (siehe Sundaresh Menon, der sehr gute Vorschläge unterbreitet), aber hier müssten eben mehr Staaten zustimmen. Diese Lösung würde ich durchaus unterstützen. Die EU-Kommission hat sich aber bisher nur zu kosmetischen Veränderungen durchgerungen, die zwar einen Fortschritt bieten, aber bei weitem noch nicht ausreichen.
Ich muss zugeben, dass ich unter dieser Prämisse den Kritikern von TTIP Recht gebe: die Investitionsschutzklausel ist ein Gift, dass alle anderen möglichen Vorteile des Abkommens zunichte macht. Wir sprechen zwar von laufenden Verhandlungen, aber ich werde zunehmend skeptisch, ob die EU-Kommission hier noch eine vernünftige Lösung finden wird, die Bürger überzeugen kann. Die Kommission steckt derzeit in einer Vertrauenskrise und ich sehe kaum Möglichkeiten die Bürger noch zu überzeugen. Die Debatte ist einfach zu hitzig.
Ich sehe aber noch eine Chance: Auch der US-Kongress steht Investitionsschutzklauseln skeptisch gegenüber. Vielleicht finden hier beide Wirtschaftsblöcke einen gemeinsamen Nenner, indem sie diese Schutzklauseln ganz weglassen oder sich auf eine Lösung verständigen, die alle oben genannten Defizite ausräumen?! Was sagt ihr?
Zum Schluss lade ich alle herzlich ein, sich die Bundestagsdebatte zu diesem Thema anzuschauen, die wirklich sehr gut ist.
Bundestag: Experten kritisieren Investorenschutz in Ceta
Literatur (Leider kann man einige der Artikel nur kaufen)
Das Globalisierungs-Paradox: Die Demokratie und die Zukunft der Weltwirtschaft
Die Freihandelslüge: Warum TTIP nur den Konzernen nützt - und uns allen schadet
Bundestag: Experten kritisieren Investorenschutz in Ceta
Gabriel plädiert für ständigen TTIP-Gerichtshof
Ole Kristian Fauchald: The Legal Reasoning of ICSID Tribunals – An Empirical Analysis
Mark Clodfelter: Do States Have a Duty to Cooperate in the Interpretation of Investment Treaties?, 2014, in: American Society of International Law